Künstliche Intelligenz
Softwareentwicklung und Training von Systemen im KI-Zeitalter
Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) macht auch vor der Software-Entwicklung nicht halt: Wird KI zur Entwicklung von Code oder z.B. für das Training von Systemen eingesetzt, so ist Vorsicht geboten. Je nach dem sollte Software selbst entwickelt werden.
KI in der Software-Entwicklung einzusetzen und Software Code KI-gestützt entwickeln zu lassen, ist nicht neu. Auch im Testing kann KI eingesetzt werden, um Testfälle zu kreieren und Resultate zu prüfen. Der Einsatz von KI hat auch Tücken: So entsteht zum Beispiel an KI-generiertem Software Code – Stand jetzt – kein Urheberschutz.
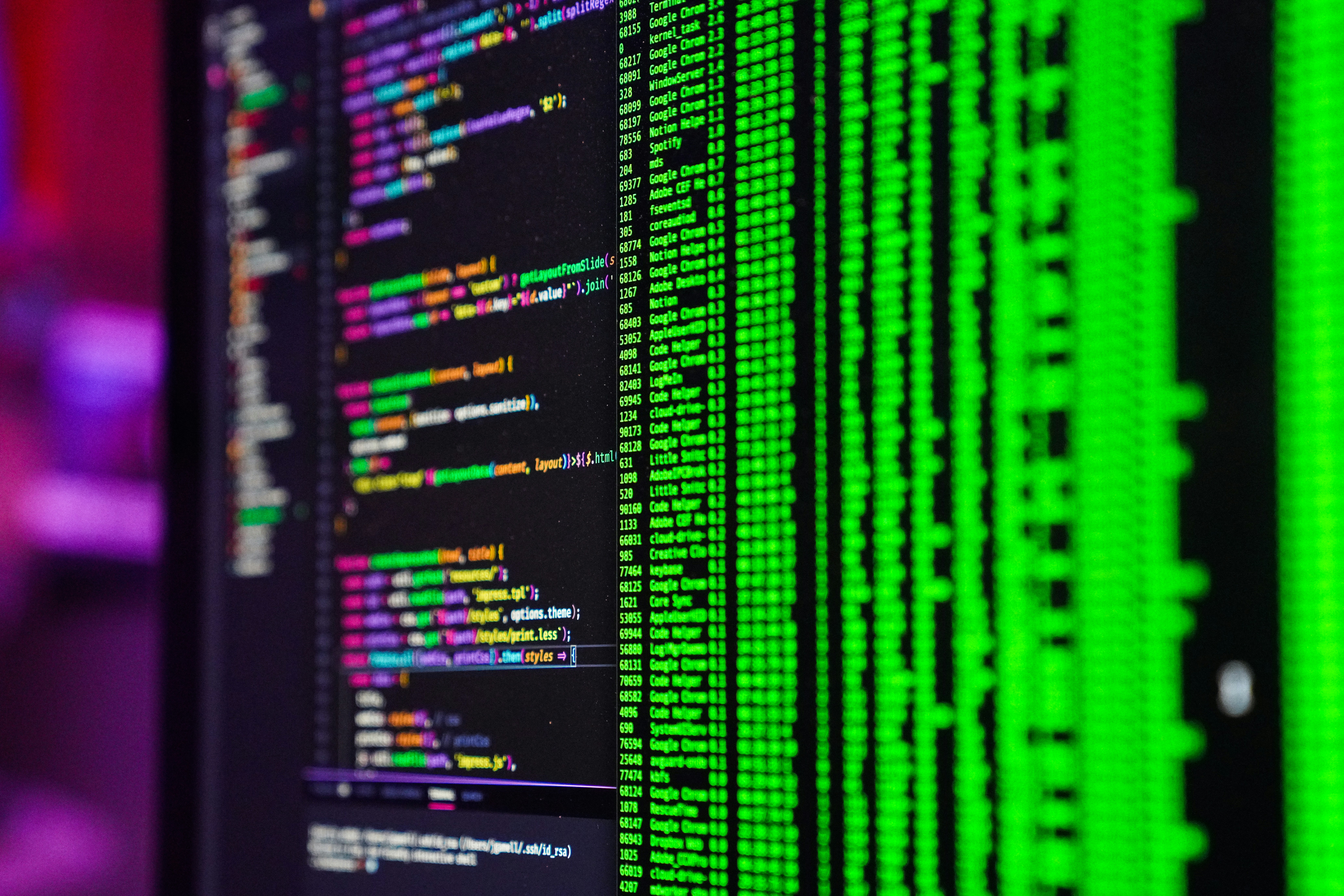 Studien zufolge wird ein grosser Teil von Codes künftig automatisiert erstellt. (Bild: Joan Gamell auf Unsplash)
Studien zufolge wird ein grosser Teil von Codes künftig automatisiert erstellt. (Bild: Joan Gamell auf Unsplash)
Software und Urheberrechtsschutz
Wer Software selbst entwickelt und programmiert, generiert ein Werk, welches nach den Grundsätzen des Urheberrechts geschützt ist. Ein urheberrechtlich geschütztes Werk fordert Kreativität und einen von einem Menschen veranlassten Vorgang , d.h. ein Mensch muss programmieren. Wird Software-Code nun KI-basiert entwickelt, so fehlt die kreative menschliche Komponente im Prozess. Der Urheberrechtsschutz ist nicht gegeben. Es könnte allenthalben noch vertreten werden, dass ein kreativer menschlicher Input zu einem Output führt, der dann Urheberschutz geniesst – gerichtliche Evidenz gibt es bisher nicht und ist eher unwahrscheinlich.
Haftung für das Softwareprodukt
Studien zufolge wird ein grosser Teil von Codes künftig automatisiert erstellt. Damit stellen sich auch haftungsrechtliche Fragen: Wird Software Code KI-basiert generiert, so trägt für das Ergebnis in erster Linie derjenige die Verantwortung, der den Code generiert und im Produkt nutzt und verkauft. Denkbar ist –je nach Konstellation – auch eine Haftung des Herstellers von GenAI. Die GenAI-Anbieter verfügen jedoch über umfangreiche Terms & Conditions mit Haftungsbeschränkungen, zudem wird im geschäftlichen Verkehr ein Gerichtsstand in den USA vereinbart.
Vertragliche Regelungen oder interne Richtlinien können haftungsrechtliche Risiken abfedern. Dabei sind jedoch vielfältige Konstellationen denkbar, insbesondere auch, wenn die programmierte Software mittels API an ein LLM angeschlossen ist und Kunden bereitgestellt wird. Durch den GenAI-Anbieter ist in deren Terms & Conditions geregelt, dass z.B. keine strafbaren Anfragen oder Inhalte erfolgen dürfen. Hier sollte die Verantwortung zwischen Softwareentwickler und Kunde im Verhältnis zum GenAI-Anbieter vertraglich vereinbart werden.
Training von Software- und KI-Systemen
Beim Training von KI-Systemen unter Verwendung bestehender Quellcodes sind rechtliche Aspekte zu beachten. Werden GenAI-Dienste genutzt, ist sicherzustellen, dass keine Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse preisgegeben werden. Datenschutzrechtliche Fragestellungen können sich ebenfalls ergeben, insbesondere wenn der Quellcode personenbezogene Daten enthält. Fehlt eine Vereinbarung zur Trainingsnutzung, kann die Verwendung eine Urheberrechtsverletzung darstellen.
Soll ein Unternehmen eigene Datenbestände für Trainingszwecke einsetzen, sind entsprechende Vereinbarungen mit dem Anbieter zu treffen. Alternativ kann das Training auf einer lokalen OnPrem-Infrastruktur erfolgen. Zudem ist sicherzustellen, dass das trainierte Modell keine systematischen Verzerrungen (Bias) aufweist, die gegen gesetzliche Vorgaben verstossen. Auch wenn in der Schweiz keine umfassende KI-Regulierung absehbar ist, entfalten europäische Vorgaben faktisch Wirkung.
Fazit
Der Einsatz von KI in der Softwareentwicklung und beim Training von Systemen bringt zahlreiche Potenziale mit sich. Gleichzeitig ist es empfehlenswert, die damit verbundenen rechtlichen Fragestellungen frühzeitig zu prüfen. Dies Prüfung sollte intern als auch im Verhältnis zu Kunden, Nutzern und KI-Anbietern erfolgen.





